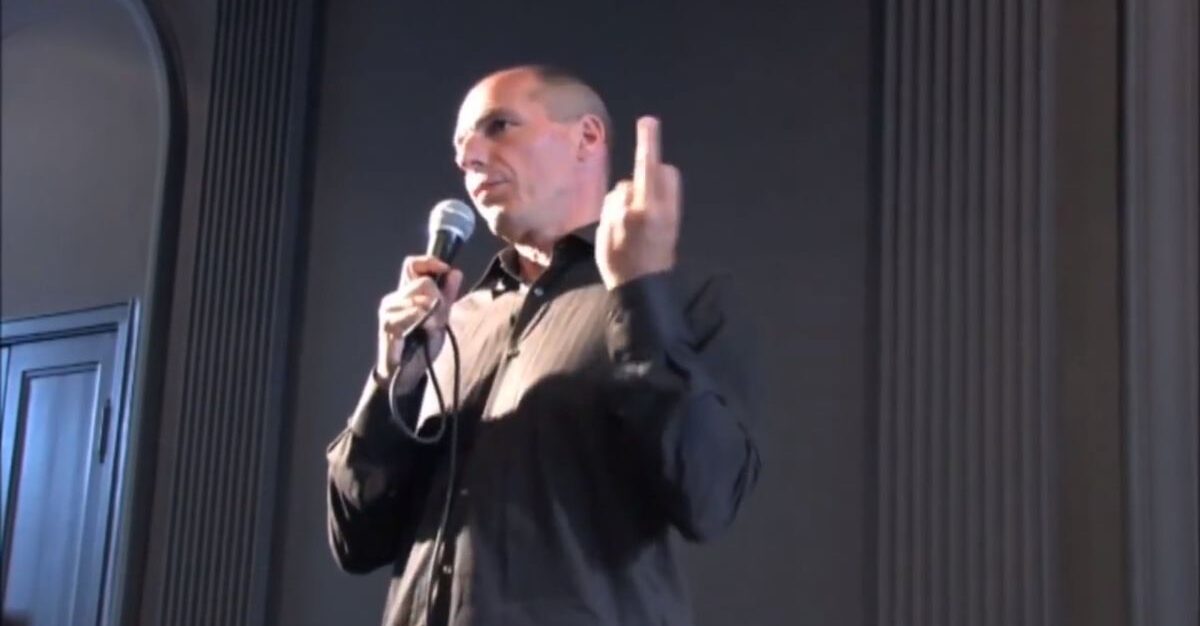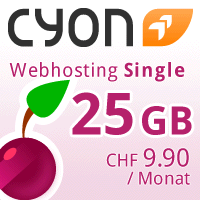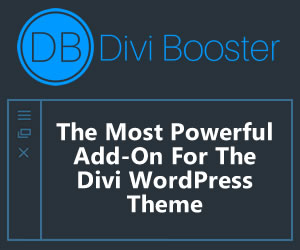Trick # 451 | Dieser Beitrag beinhaltet 1321 Wörter. – Geschätzte Lesezeit: ca. 7 Minuten.
Heute mal eine etwas andere Geschichte. Kein Code, kein Hack – stattdessen nehmen wir uns dem Phänomen «DeepFakes» an. Mit wenigen Klicks lässt sich nämlich im Netz mit künstlicher Intelligenz KI viel Unfug anstellen. Rechtlich aber oft jenseits aller Grauzonen.
Freilich: Nicht alle DeepFakes sind bösartig gemeint. Es gibt auch viele Beispiele für humorvolle, kreative oder satirische Anwendungen – etwa wenn bekannte Schauspieler in Filmszenen «ersetzt» werden oder Politikerinnen plötzlich in Musical-Nummern auftreten. Solche Clips können unterhaltsam sein und zeigen, wie faszinierend die Technik ist.
Der Grat zwischen Spass und Irreführung ist allerdings schmal. Gerade wenn DeepFakes täuschend realistisch wirken, erkennen viele Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr, was echt ist – und was nicht. Das untergräbt langfristig das Vertrauen in Bilder, Videos und letztlich auch in die Realität.
KI und Erotik: Eine vorhersehbare Kombination
Das Internet war nie nur ein Ort für Information, Bildung und Austausch – seit den frühesten Tagen wird es auch für erotische und pornografische Inhalte genutzt. Dieser Aspekt war treibende Kraft für viele technische Entwicklungen: bessere Videoformate, schnellere Ladezeiten, neue Geschäftsmodelle. Und nun, mit dem Aufstieg der Künstlichen Intelligenz, zeigt sich ein bekanntes Muster: Auch KI wird intensiv für erotische Anwendungen verwendet.
Dass KI auch im Bereich der Sexualität Einzug hält, ist keine Überraschung. Was früher mit Photoshop aufwändig gebastelt wurde, lässt sich heute mit einem Klick generieren. Auch realistisch wirkende Nacktbilder, erzeugt aus völlig harmlosen Porträtfotos. Die Qualität dieser sogenannten DeepNudes ist erschreckend gut. Und das Angebot an Online-Diensten, die aus einem normalen Foto ein Nacktbild erzeugen, wächst rasant.
Die DeepFake-Technologie wurde ursprünglich entwickelt, um Gesichter in Videos oder Bildern auszutauschen – heute wird sie zunehmend dazu missbraucht, um Personen ohne deren Einverständnis in kompromittierenden Posen darzustellen. Opfer sind häufig Frauen, die sich nie in einem solchen Kontext abbilden lassen würden.
Eine einfache Google-Suche reicht aus, um auf zahlreiche DeepFake- oder DeepNude-Angebote zu stossen – viele davon sind kostenlos nutzbar. Die Resultate sind oft erschreckend realistisch: Aus einem harmlosen Selfie entsteht so in Sekunden ein täuschend echt wirkendes Nacktbild.
Links ein harmloses KI-generiertes Bild – rechts das Resultat einer DeepFake-Bearbeitung. Viele dieser Tools wären in der Lage, Originale viel stärker zu manipulieren und deutlich explizitere Bilder zu generieren.
Zwar weisen viele dieser Plattformen darauf hin, dass Fotos nur mit dem Einverständnis der abgebildeten Person verwendet werden dürfen – doch dieser Hinweis ist kaum mehr als eine Alibiübung. Ein simples «OK» genügt, und der Dienst wird aktiv. Eine ernsthafte Kontrolle oder Verifikation findet nicht statt. Damit wird der Missbrauch zum Kinderspiel.
Die rechtliche Lage in der Schweiz
Das Erzeugen und Verbreiten solcher Bilder ohne Einwilligung ist rechtlich mehr als nur problematisch. In der Schweiz schützt das Persönlichkeitsrecht jede Person vor derartiger Entblössung. Konkret regelt Art. 28 ZGB, dass sich jede Person gegen widerrechtliche Verletzungen ihrer Persönlichkeit wehren kann – etwa, wenn ihr Bild ohne Zustimmung manipuliert oder gar veröffentlicht wird.
Auch das Strafgesetzbuch kommt ins Spiel: Wer ein DeepFake-Bild erstellt oder verbreitet, kann sich unter anderem wegen Verletzung der Geheim- oder Privatsphäre oder sogar Pornografiedelikten strafbar machen – insbesondere wenn die abgebildete Person minderjährig ist.
Und schliesslich ist auch das Datenschutzgesetz von Relevanz. Dieses schützt personenbezogene Daten, zu denen auch Bilddaten gehören.
Betroffene sind nicht hilflos
Wer betroffen ist, steht oft unter Schock – und weiss nicht, wie er oder sie reagieren soll. Hier einige konkrete Schritte:
- Beweise sichern: Screenshots machen, URLs speichern, Chatverläufe dokumentieren.
- Plattform informieren: Die meisten seriösen Plattformen reagieren auf Hinweise und löschen solche veröffentlichten Inhalte schnell.
- Rechtliche Schritte prüfen: Eine Anwältin oder ein Anwalt kann helfen, zivil- und strafrechtlich gegen TäterInnen vorzugehen.
- Hilfe in Anspruch nehmen: Betroffene können sich machtlos fühlen. Doch Beratungsstellen oder Organisationen wie HateAid (in Deutschland) oder die Plattform gegen digitale Gewalt (in der Schweiz) bieten Unterstützung.
- Mediensperren beantragen: Wer befürchten muss, dass sein Bildmaterial in der Presse oder auf Suchmaschinen erscheint, kann eine Mediensperre beantragen.
Fazit: Technologie braucht Verantwortung
DeepFakes sind ein Beispiel dafür, wie leistungsfähig – und gefährlich – moderne KI sein kann. Die Technik selbst ist dabei nicht das Problem; entscheidend ist, wie sie eingesetzt wird. Was als Spielerei begann, ist längst ein ernsthaftes Problem geworden, das Persönlichkeitsrechte und den Schutz der Privatsphäre tiefgreifend verletzen kann.
Gerade in der digitalisierten Gesellschaft ist es wichtig, nicht nur technische, sondern auch ethische und rechtliche Leitplanken zu etablieren. Denn wer heute auf einem harmlosen Foto lächelt, könnte morgen – ohne es zu wollen – Teil eines DeepFakes sein.
Werbung